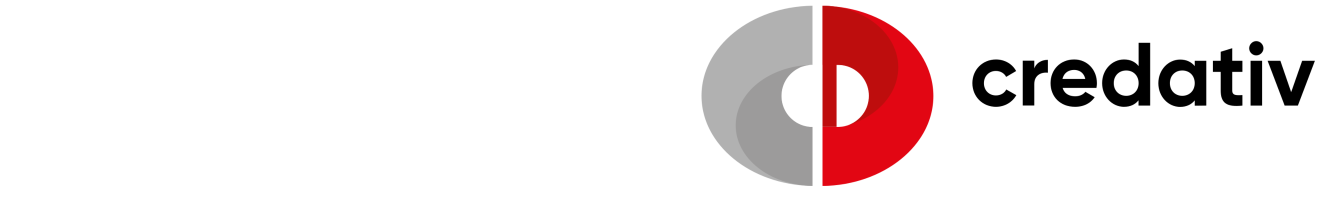Vor genau 20 Jahren, im November 1999, wurde die credativ GmbH gegründet.
Den Geschäftsbetrieb nahmen damals Dr. Michael Meskes und Jörg Folz im Technologiezentrum Jülich auf. Unser Anspruch war dabei schon immer, dass wir nicht nur arbeiten um zu leben, sondern unsere Arbeit auch leben und lieben wollen. Dabei ist unser Ziel, die Verbreitung von Open Source Software zu unterstützen und für eine Unabhängigkeit von Softwareherstellern zu sorgen.
Außerdem ist credativ eine enge Zusammenarbeit mit Open-Source-Communities wichtig. Seit unserer Gründung vergeht kein Jahr, in dem wir nicht an PostgreSQL®– oder Debian-Veranstaltungen teilnehmen, oder diese finanziell unterstützen. Da uns auch die Weiterentwicklung des Linux Betriebssystems am Herzen liegt, sind wir seit über 10 Jahren Mitglied der Linux Foundation.
Im Jahr 2006 haben wir unser Open Source Support Center eröffnet. Hier hatten unsere Kunden erstmalig die Möglichkeit, den Support für ihre gesamte Open Source Infrastruktur über einen Vertrag abzudecken.
Dank unserem gesunden und stetigen Wachstum hatte die credativ zu ihrem 10-jährigen Bestehen bereits über 35 Mitarbeiter an ihren weltweiten Standorten.
Zusäzlich erweiterten wir im Jahr 2013 unsere Geschäftsführung um Sascha Heuer. Durch die Gründung der credativ international GmbH im selben Jahr konnte Dr. Michael Meskes ebenfalls die Expansion in Länder wie USA und Indien vorantreiben.
Mit mittlerweile über 55 Mitarbeitern und 20 Jahren Firmengeschichte ist die credativ GmbH eines der führenden Unternehmen für Open Source Software im Enterprise-Einsatz. Wir danken unseren Kunden, Geschäftspartnern und Mitarbeitern für die gemeinsame Zeit.
Weitere Informationen über unsere Historie sowie unsere Firmenphilosophie finden Sie auf den entsprechenden Infoseiten.
Dieser Artikel wurde ursprünglich von Philip Haas geschrieben.
Die PostgreSQL® Global Development Group (PGDG) hat Version 12 der populären, freien Datenbank PostgreSQL® freigegeben. Wie unser Artikel für Beta 4 bereits angedeutet hat, sind eine Vielzahl von neuen Features, Verbesserungen und Optimierungen in das Release eingeflossen. Dazu gehören unter anderem:
Optimierte Speicherplatznutzung und Geschwindigkeit bei btree-Indexen
btree-Indexe, der Standardindextyp in PostgreSQL®, hat einige Optimierungen in PostgreSQL® 12 erfahren.
btree Indexe speicherten in der Vergangenheit Doubletten (also mehrfache Einträge mit denselben Schlüsselwerten) in einer unsortierten Reihenfolge. Dies hatte eine suboptimale Nutzung der physischen Repräsentation in betreffenden Indexen zu Folge. Eine Optimierung speichert diese mehrfachen Schlüsselwerte nun in derselben Reihenfolge, wie diese auch physisch in der Tabelle gespeichert sind. Dies verbessert die Speicherplatzausnutzung und die Aufwände für das Verwalten entsprechender Indexe vom Typ btree. Darüber hinaus verwenden Indexe mit mehreren indizierten Spalten eine verbesserte physische Repräsentation, sodass deren Speicherplatznutzung ebenfalls verbessert wird. Um hiervon in PostgreSQL® 12 zu profitieren, müssen diese jedoch, falls per binärem Upgrade mittels pg_upgrade auf die neue Version gewechselt wurde, diese Indexe neu angelegt bzw. reindiziert werden.
Einfügeoperationen in btree-Indexe werden zudem durch verbessertes Locking beschleunigt.
Verbesserungen für pg_checksums
credativ hat eine Erweiterung für pg_checksums beigesteuert, die es ermöglicht Blockprüfsummen in gestoppten PostgreSQL®-Instanzen zu aktivieren oder zu deaktivieren. Vorher konnte dies nur durch ein Neuanlegen der physischen Datenrepräsentation des Clusters per initdb durchgeführt werden.
pg_checksums verfügt nun auch mit dem Parameter --progress über die Möglichkeit, einen Statusverlauf auf der Konsole anzuzeigen. Die entsprechenden Codebeiträge stammen von den Kollegen Michael Banck und Bernd Helmle.
Optimizer Inlining von Common Table Expressions
Bis einschließlich PostgreSQL® 11 war es dem PostgreSQL® Optimizer nicht möglich, Common Table Expressions (auch CTE oder WITH Abfragen genannt) zu optimieren. Wurde ein solcher Ausdruck in einer Abfrage verwendet, so wurde die CTE immer als erstes evaluiert und materialisiert, bevor der Rest der Abfrage abgearbeitet wurde. Dies führte bei komplexeren CTE Ausdrücken zu entsprechend teuren Ausführungsplänen. Folgendes generisches Beispiel illustriert dies anschaulich. Gegeben sei ein Join mit einem CTE Ausdruck, der alle gerade Zahlen aus einer numerischen Spalten filtert:
WITH t_cte AS (SELECT id FROM foo WHERE id % 2 = 0) SELECT COUNT(*) FROM t_cte JOIN bar USING(id);
In PostgreSQL® 11 führt die Verwendung einer CTE immer zu einem CTE Scan, der den CTE Ausdruck als erstes materialisiert:
EXPLAIN (ANALYZE, BUFFERS) WITH t_cte AS (SELECT id FROM foo WHERE id % 2 = 0) SELECT COUNT(*) FROM t_cte JOIN bar USING(id) ;
QUERY PLAN
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Aggregate (cost=2231.12..2231.14 rows=1 width=8) (actual time=48.684..48.684 rows=1 loops=1)
Buffers: shared hit=488
CTE t_cte
-> Seq Scan on foo (cost=0.00..1943.00 rows=500 width=4) (actual time=0.055..17.146 rows=50000 loops=1)
Filter: ((id % 2) = 0)
Rows Removed by Filter: 50000
Buffers: shared hit=443
-> Hash Join (cost=270.00..286.88 rows=500 width=0) (actual time=7.297..47.966 rows=5000 loops=1)
Hash Cond: (t_cte.id = bar.id)
Buffers: shared hit=488
-> CTE Scan on t_cte (cost=0.00..10.00 rows=500 width=4) (actual time=0.063..31.158 rows=50000 loops=1)
Buffers: shared hit=443
-> Hash (cost=145.00..145.00 rows=10000 width=4) (actual time=7.191..7.192 rows=10000 loops=1)
Buckets: 16384 Batches: 1 Memory Usage: 480kB
Buffers: shared hit=45
-> Seq Scan on bar (cost=0.00..145.00 rows=10000 width=4) (actual time=0.029..3.031 rows=10000 loops=1)
Buffers: shared hit=45
Planning Time: 0.832 ms
Execution Time: 50.562 ms
(19 rows)
Dieser Plan materialisiert zunächst die CTE mit einem Sequential Scan mit entsprechendem Filter (id % 2 = 0). Hier wird kein funktionaler Index verwendet, daher ist dieser Scan entsprechend teurer. Danach wird das Ergebnis der CTE per Hash Join mit der entsprechenden Join Bedingung mit der Tabelle bar verknüpft. Mit PostgreSQL® 12 erhält der Optimizer nun die Fähigkeit, diese CTE Ausdrücke ohne vorherige Materialisierung zu inlinen. Der zugrundeliegende, optimierte Plan in PostgreSQL® 12 sieht dann wie folgt aus:
EXPLAIN (ANALYZE, BUFFERS) WITH t_cte AS (SELECT id FROM foo WHERE id % 2 = 0) SELECT COUNT(*) FROM t_cte JOIN bar USING(id) ;
QUERY PLAN
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Aggregate (cost=706.43..706.44 rows=1 width=8) (actual time=9.203..9.203 rows=1 loops=1)
Buffers: shared hit=148
-> Merge Join (cost=0.71..706.30 rows=50 width=0) (actual time=0.099..8.771 rows=5000 loops=1)
Merge Cond: (foo.id = bar.id)
Buffers: shared hit=148
-> Index Only Scan using foo_id_idx on foo (cost=0.29..3550.29 rows=500 width=4) (actual time=0.053..3.490 rows=5001 loops=1)
Filter: ((id % 2) = 0)
Rows Removed by Filter: 5001
Heap Fetches: 10002
Buffers: shared hit=74
-> Index Only Scan using bar_id_idx on bar (cost=0.29..318.29 rows=10000 width=4) (actual time=0.038..3.186 rows=10000 loops=1)
Heap Fetches: 10000
Buffers: shared hit=74
Planning Time: 0.646 ms
Execution Time: 9.268 ms
(15 rows)
Der Vorteil dieser Methode ist, dass das initiale materialisieren des CTE Ausdrucks entfällt. Stattdessen wird die Abfrage direkt mit einem Join ausgeführt.
Dies funktioniert bei allen nicht-rekursiven CTE Ausdrücken ohne Seiteneffekte (beispielsweise CTEs mit Schreibanweisungen) und solchen, die jeweils nur einmal pro Abfrage referenziert sind. Das alte Verhalten des Optimizers kann mit der Anweisung WITH ... AS MATERIALIZED ... forciert werden.
Generated Columns
Neu in PostgreSQL® 12 sind sogenannte Generated Columns, die auf Ausdrücken basierend ein Ergebnis anhand vorhandener Spaltenwerte berechnen. Diese werden mit den entsprechenden Quellwerten im Tupel gespeichert. Der Vorteil ist, dass das Anlegen von Triggern zur nachträglichen Berechnung von Spaltenwerten entfallen kann. Folgendes einfaches Beispiel anhand einer Preistabelle mit Netto und Bruttopreisen illustriert die neue Funktionalität:
CREATE TABLE preise(netto numeric,
brutto numeric GENERATED ALWAYS AS (netto * 1.19) STORED);
INSERT INTO preise VALUES(17.30);
INSERT INTO preise VALUES(225);
INSERT INTO preise VALUES(247);
INSERT INTO preise VALUES(19.15);
SELECT * FROM preise;
netto │ brutto
───────┼─────────
17.30 │ 20.5870
225 │ 267.75
247 │ 293.93
19.15 │ 22.7885
(4 rows)
Die Spalte brutto wird direkt aus dem Nettopreis berechnet. Das Schlüsselwort STORED ist Pflicht. Selbstverständlich können auf Generated Columns auch Indexe erzeugt werden, allerdings können sie nicht Teil eines Primärschlüssels sein. Ferner muss der SQL Ausdruck eindeutig sein, d.h. auch bei gleicher Eingabemenge das dasselbe Ergebnis liefern. Spalten die als Generated Columns deklariert sind, können nicht explizit in INSERT– oder UPDATE-Operationen verwendet werden. Falls eine Spaltenliste unbedingt notwendig ist, kann mit dem Schlüsselwort DEFAULT der entsprechende Wert indirekt referenziert werden.
Wegfall von expliziten OID Spalten
Explizite OID Spalten waren historisch gesehen ein Weg, eindeutige Spaltenwerte zu erzeugen, so dass eine Tabellenzeile Datenbankweit eindeutig identifiziert werden kann. Seit langer Zeit werden diese in PostgreSQL® jedoch nur noch explizit angelegt und deren grundlegende Funktionalität als überholt angesehen. Mit PostgreSQL® wird nun auch die Möglichkeit explizit solche Spalten anzulegen, endgültig abgeschafft. Damit wird es nicht mehr möglich sein, die Direktive WITH OIDS bei Tabellen anzugeben. Systemtabellen, die schon immer per OID Objekte eindeutig referenzieren, geben OID Werte ab sofort ohne explizite Angabe von OID Spalten in der Ergebnismenge zurück. Besonders ältere Software, die sorglos mit Katalogabfragen hantierte, könnte Probleme durch eine doppelte Spaltenausgabe bekommen.
Verschieben der recovery.conf in die postgresql.conf
Bis einschließlich PostgreSQL® 11 konfigurierte man Datenbankrecovery und Streaming Replication Instanzen über eine separate Konfigurationsdatei recovery.conf.
Mit PostgreSQL® 12 wandern nun sämtliche dort getätigte Konfigurationsarbeiten in die postgresql.conf. Die Datei recovery.conf entfällt ab sofort. PostgreSQL® 12 weigert sich zu starten, sobald diese Datei vorhanden ist. Ob Recovery oder ein Streaming Standby gewünscht ist, entscheidet nun entweder eine Datei recovery.signal (für Recovery) oder standby.signal (für Standby Systeme). Letztere hat bei Vorhandensein beider Dateien den Vorrang. Der alte Parameter standby_mode, der dieses Verhalten seither kontrollierte, wurde entfernt.
Für automatische Deployments von hochverfügbaren Systemen bedeutet dies eine große Änderung. Allerdings ist es nun auch möglich, entsprechende Konfigurationsarbeiten fast vollständig per ALTER SYSTEM vorzunehmen, sodass man nur noch eine Konfigurationsdatei pflegen muss.
REINDEX CONCURRENTLY
Mit PostgreSQL® 12 gibt es nun eine Möglichkeit, Indexe mit so geringen Sperren wie möglich neu anzulegen. Dies vereinfacht einer der häufigsten Wartungsaufgaben in sehr schreiblastigen Datenbanken erheblich. Zuvor musste mit einer Kombination aus CREATE INDEX CONCURRENTLY und DROP INDEX CONCURRENTLY gearbeitet werden. Hierbei musste man auch aufpassen, dass Indexnamen entsprechend neu vergeben wurden.
Die Release Notes geben eine noch viel detailliertere Übersicht über alle Neuerungen und vor allem auch Inkompatiblitäten gegenüber den vorangegangenen PostgreSQL® Versionen.
„Mit credativ tritt ein weiterer wichtiger Open Source Partner in die OpenChain Community ein und hilft das Management von Open Source Software und deren Lizenzen einfacher und transparenter zu gestalten,“ sagt Shane Coughlan, OpenChain Program Manager. „Die credativ ist eine der frühen Supporter von Freier und Open Source Software, die der OpenChain Community beitritt. Sie haben sich den richtigen Zeitpunkt gewählt beizutreten. Wir freuen uns darauf in Zukunft eng zusammen zu arbeiten und durch den gemeinsamen Einfluss mehr Bewusstsein für das OpenChain Zertifikat in den Märkten wie Europa, Amerika und Indien zu schaffen.“
Weiterhin erklärt Dr. Michael Meskes, Geschäftsführer der credativ dazu folgendes:
„Es ist für uns eine großes Anliegen der OpenChain Community beizutreten. Durch unsere langjährige Erfahrung mit Open Source im betrieblichen Bereich kommen wir in Kontakt mit vielen verschiedenen Unternehmen und wissen den positiven Effekt von Open Source zu verbessern, nicht nur in technischen sondern auch in Compliance Fragen. Daher möchten wir durch unsere Konformität mit den OpenChain Spezifikationen die Bekanntheit dieses Projekts weiter vorantreiben, sodass in Zukunft mehr und mehr Unternehmen Vertrauen in Free und Open Source Software gewinnen. Einer der wichtigen Aspekte der OpenChain Zertifizierung ist, dass sie Vertrauen schafft, welches verankert in den Grundsätzen von Free und Open Source Software ist und somit einen essenziellen Beitrag zur allgemeinen Akzeptanz von Open Source beitragen kann.“
Das OpenChain Projekt identifiziert Schlüsselprozesse für effektives Open Source Software Komponenten Management. Zu diesen gehören unter anderem das Besitzen einer allgemeinen Free und Open Source Software Strategie, regelmäßiges Training aller Entwickler und Techniker, die bei der Entstehung von Software mitwirken, und die Festlegung von Standards im Umgang mit Lizenzen und genereller Kontribution zu verschiedenen Open Source Projekten. Behandelt sind zum Beispiel Themen wie Distribution von Software in Binary- oder in Source-Form, Modifikation oder Integration von Open Source Software Komponenten und Interaktionen verschiedener Lizenzen.
Auf diese Art macht es Management von Open Source Software Komponenten simpler, einheitlicher und schafft Vertrauen in Free und Open Source Software generell.
Die OpenChain Spezifikationen definieren eine Grundmenge von Vorgaben und Voraussetzungen die jedes Qualitäts Compliance Programm im Bereich von Open Source erfüllen muss. Das OpenChain Curriculum stellt zudem ein Basiswissen in Form von hilfreichen Dokumenten, die Prozesse und Lösungen in Verbindung mit Open Source Software erklären, und gleichzeitig einen Teil der OpenChain Spezifikationen erfüllen. Durch die OpenChain Conformance wird es Unternehmen ermöglicht die Beachtung und Einhaltung der vorgegebenen Regeln und Spezifikationen bekannt zu geben und gleichzeitig ein Teil der OpenChain Community zu werden.
Als Resultat dieser von OpenChain vorgegebenen Prozesse, wird Open Source Lizenzkonformität kalkulierbarer, einfacher zu verstehen und effizienter für alle Mitwirkenden in einer Software Lieferkette.
Unternehmen jeder Größe sind eingeladen das OpenChain Projekt zu begutachten und ihre komplett kostenfreie Online Selbst-Zertifizierung zu absolvieren, und somit der OpenChain Community of trust beizutreten.
Über credativ:
Die credativ ist ein herstellerunabhängiges Beratungs- und Dienstleistungsunternehmen mit Standorten in Deutschland, Spanien, Indien, den Niederlanden und den USA. Seit der Gründung in 1999 spezialisiert credativ sich auf die Planung und Realisierung professioneller Businesslösungen unter Verwendung von Free und Open Source Software. Mehr Informationen unter https://www.credativ.de
Über die Linux Foundation:
Die Linux Foundation ist das Unternehmen Ihrer Wahl für weltweit leitende Entwickler und Firmen um ein gemeinsames Ökosystem zu bauen durch welches die Entwicklung von offenen Technologien vorangetrieben und deren kommerzielle Adaption verbessert wird. Zusammen mit der weltweiten Open Source Community, beseitigt die Linux Foundation die herausfordernsten technologischen Probleme indem sie das größte Investment in gemeinsame Technologie der heutigen Zeit tätigt. Gegründet im Jahr 2000, bietet die Linux Foundation heutzutage Tools, Trainings und Events um mehr Bewusstsein für allerlei Open Source Projekte zu schaffen, welche gemeinsam eine wirtschaftliche Bedeutung darstellen, die nicht mit einem alleinigen Unternehmen erreichbar wäre. Mehr Informationen können unter https://www.linuxfoundation.org gefunden werden.
Die Linux Foundation hat und nutzt eingetragene und Markenrechtlich geschützte Namen und Logos. Eine Liste aller Marken sind auf der trademark usage page gelistet: https://www.linuxfoundation.org/trademark-usage. Linux ist eine eingetragene Marke von Linus Torvald.
OpenChain Blogpost: https://www.openchainproject.org/news/2017/08/07/openchain-welcomes-credativ
Ein Gastbeitrag von Thimo Hüller – Black Duck Software
Jedes Jahr werden über 4.000 neue, in Open Source Software (OSS) enthaltene Sicherheitslücken bekannt. Die Wahrscheinlichkeit, dass sich auch in Ihrem Software-Portfolio solche Schwachstellen befinden ist hoch.
Der erste Schritt zur Entwicklung und Betrieb von sicheren Anwendungen ist, solche verwundbaren Stellen in Ihrer Codebase zu identifizieren. Aber das ist nicht so einfach, denn in den verwendeten Plattformen, Libraries und Utilitycodes sind oft Hunderte, wenn nicht Tausende von Open-Source-Modulen integriert. Hinzu kommt, dass oftmals Elemente der Codebase von verschiedenen Entwicklergruppen an verschiedenen Orten bearbeitet werden. Die Überprüfung sämtlicher verwendeter Open-Source-Software auf Sicherheitslücken kann sehr zeitaufwendig sein, die Software-Build-Prozesse verlangsamen und eine Continuous Integration Umgebung zum Stillstand bringen.
Es ist daher nicht verwunderlich, dass sich Entwickler- und DevOps-Teams solche Sicherheitsüberprüfungen bis zuletzt im Software-Entwicklungszyklus aufsparen. Das Ergebnis sind dann Apps, die längst veraltete Open-Source-Komponenten enthalten und mit hoher Wahrscheinlichkeit latente Sicherheitslücken haben.
Um diesem Problem zu Leibe zu rücken, können Entwickler jetzt das kostenlose Black Duck Free Vulnerability Plug-in für Jenkins herunterladen. Dieses frei verfügbare Tool ermöglicht es Entwicklern und DevOps Managern, bekannte Sicherheitslücken in Open-Source-Komponenten schnell und leicht zu finden. Dies geschieht schon früh im Entwicklungsprozess, wenn korrigierende Maßnahmen weniger störend sind und vor allem kostengünstiger durchgeführt werden können.
Das Vulnerability Plug-in verwendet Informationen aus der Black Duck KnowledgeBase in Kombination mit relevanten Daten aus dem Jenkins Build-System. Es macht es leicht, Open-Source-Versionen zu erkennen und die für diese Komponenten katalogisierten Sicherheitslücken anzuzeigen. Der Trick ist die Automatisierung!
Das Plugin reduziert zeitraubende, manuelle Inspektionen auf ein Minimum und behindert nicht tägliche oder stündliche Build-Vorgänge und die damit verbundenen Agile Sprints. Entwickler können aussagekräftige PDF-Berichte exportieren, auf denen die Sicherheitslücken gelistet sind, diese dann mit den Sicherheitsteams und Systemarchitekten besprechen und Korrekturmaßnahmen entscheiden.
Sicherheitslücken früh im Entwicklungsprozess zu erkennen spart Ressourcen und kostbare Entwicklerzeit. Es hilft schlussendlich, qualitativ besseren Code und damit auch sichere Anwendungen zu erstellen. Probieren Sie’s aus!
Laden sie das Jenkins Plugin hier kostenlos herunter.
Ein Gastbeitrag von Thimo Hüller / Black Duck Software
Der umfangreiche Einsatz von Open Source Software erfordert nicht nur ein umfassendes Konzept für Inventarisierung, Softwaremanagement, Pflege und Softwareverteilung, sondern auch eine effiziente Absicherung gegen weitere Risiken, die leider nur allzu oft vernachlässigt werden.
Im Rahmen unserer engen Zusammenarbeit mit Black Duck Software haben wir bereits vielen Kunden dabei geholfen die Herausforderungen, die durch den Einsatz von Open Source Software entstanden sind zu meistern.
Die Versprechungen von Open Source, wie eine schnellere Entwicklungsgeschwindigkeit, verkürzte Time-to-market durch eine höhere Entwicklerproduktivität und damit geringere Kosten, sind vielfach eingetreten, belegt durch den ständig steigenden Verbreitungsgrad von Open Source. Darüber hinaus hat Open Source im Umfeld der mobilen Anwendungen mit Android, oder auch im Bereich der analytischen Lösungen mit Big Data, völlig neue Märkte und Geschäftsmodelle ermöglicht.
Aber wie immer im Leben hat eine Sache aber nicht nur Vorteile, sondern stellt Unternehmen vor Herausforderungen, die wenn sie nicht gelöst werden, zu Nachteilen werden oder sogar Gefahren in sich bergen.
Zu den mögliche Gefahrenquellen gehören auch folgende Risiken:
1. Lizenz Risiko
Für Entwickler ist es leicht, Open Source kostenlos aus dem Internet herunterzuladen. Damit greifen bisherige formale Beschaffungsprozesse für Dritt-Software nicht mehr. Dabei werden oft die Lizenzverpflichtungen übersehen, derer es viele gibt und die bei falscher Verwendung erhebliche rechtliche Risiken für das Unternehmen beinhalten.
2. Operationelle Risiken
Die Suche und Beurteilung von geeignetem Code für das nächstes Projekt kann beschwerlich sein. So sollte man sich z.B. fragen, ob die gewünschte Komponente von einer aktiven Community gepflegt und weiterentwickelt wird. Wichtig ist auch, das im späteren Betrieb Klarheit daüber zu haben, um wie viele Versionen die in der Anwendung verbauten Komponenten hinter den aktuellsten Versionen zurück liegen.
3. Risiken durch bekannte Sicherheitslücken
Gerade Open Source Komponenten gelten als besonders sicher und das beweisen auch die jährlich über 4.000 erkannten Security Vulnerabilities, die in den einschlägigen Datenbanken publiziert werden und im Regelfall von der Community in einer neuen Version behoben werden.
Besonders in den Fokus gerückt ist durch Heartbleed und Shellshock das Risiko durch Sicherheitslücken. Um hier schnell und mit möglichst wenig Aufwand reagieren zu können, wird eine jederzeit aktuelle Stückliste benötigt, die Auskunft darüber gibt, wo und in welcher Version eine Open Soure Komponente verwendet wird. Da neue Security Vulnerabilities jederzeit entdeckt werden können, ist ein kontinuierliches Monitoring aller Komponenten notwendig.
Wie schützt sich Ihr Unternehmen vor diesen Risiken?
Gemeinsam mit Black Duck Software können wir auch Ihrem Unternehmen dabei helfen sich gegen diese Risiken abzusichern.
Für Fragen zu diesem Thema stehen ihnen Thimo Hüller (Blackduck Software) und Michael Amstadt (credativ GmbH) jederzeit gern zur Verfügung.